Millionen Plätze für den Ernstfall: Deutschlands neuer Schutzraum-Plan
- crisewise Redaktion

- 6. Juni
- 5 Min. Lesezeit
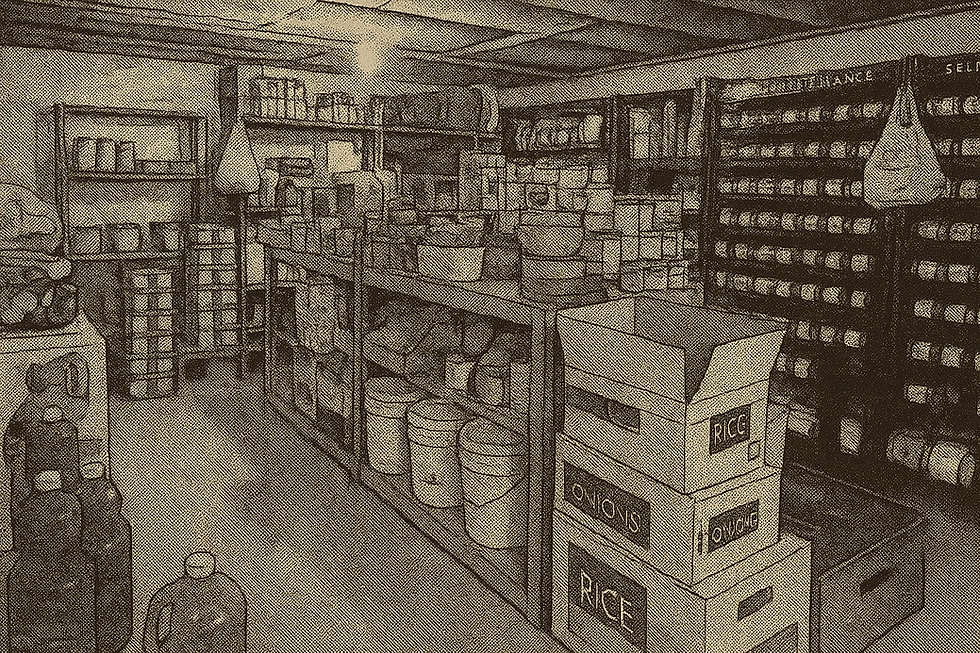
Deutschland investiert wieder massiv in den Bevölkerungsschutz. Nachdem in den vergangenen 18 Jahren keine öffentlichen Schutzräume mehr instandgehalten wurden, soll nun rasch Platz für eine Million Menschen entstehen. Warum das wichtig ist, wie es konkret aussehen soll und was Bürgerinnen und Bürger selbst tun können, fasst dieser Beitrag zusammen.
Warum Schutzräume plötzlich wieder Thema sind
Seit Ende des Kalten Krieges galten Bunker und öffentliche Schutzräume in Deutschland als überflüssig. 2007 strichen Bund und Länder die „funktionale Instandhaltung“ – seither verfielen Keller, Tiefgaragen und alte Bunker, obwohl etwa noch 579 Schutzräume mit Platz für rund 500.000 Menschen registriert waren.
Doch der Bundespräsident des Bevölkerungsschutzamtes (BBK), Ralph Tiesler, warnt: Die Lage in Europa hat sich in den letzten Jahren verschärft. Es bestehe das Risiko eines großen Angriffskriegs, etwa durch Raketen oder Drohnen. Deshalb müsse Deutschland schnell wieder flächendeckend Schutz bieten.
Aktueller Stand: Fast alle Bunker unbenutzbar
2007 stellten Bund und Länder gemeinsam den Ausbau und die Pflege öffentlicher Schutzräume ein.
579 Schutzräume (Keller, Tiefgaragen, Bahnhöfe, ehemalige Luftschutzbunker) sind technisch noch vorhanden, bieten aber gemeinsam Platz für nur rund 477.593 Menschen, und kein einziger ist derzeit einsatzbereit.
In Bayern stehen aktuell noch 150 Räume zur Verfügung, die gemeinsam aber nur 96.000 Schutzplätze bieten. Auch sie werden seit Jahren nicht gewartet. Der „Goethebunker“ in Schweinfurt (für knapp 1.000 Personen ausgelegt) wird zwar gelegentlich inspiziert, ist aber offiziell stillgelegt.
Die neue Zielmarke: Eine Million Schutzplätze
Öffentliche Räume ertüchtigen statt neu bauen
Der Aufbau klassischer Bunker kostet Zeit und sehr viel Geld. Deshalb schlägt das BBK vor, bestehende Tiefgaragen, U-Bahn-Stationen, Tunnel und Keller öffentlicher Gebäude in Schutzräume umzuwandeln. So ließen sich sehr schnell Platzkapazitäten schaffen, ohne komplett neue Anlagen zu bauen.
Tiesler: „Wir wollen eine Million Schutzplätze schaffen.“
Zeitplan: Ein ausführliches Konzept soll im Sommer 2025 vorliegen. Dann können Behörden in ganz Deutschland konkret planen, welche Parkhäuser, U-Bahn-Stationen und Stadthallen gesichert werden.
Ausstattung und Versorgung
Die Schutzräume sollen nicht nur kurzzeitig Unterschlupf bieten, wenn Raketen oder Drohnen einschlagen. Vielmehr plant das BBK, dass Menschen mehrere Tage in den Räumen bleiben können:
Notstrom- und Wasserversorgung
Toiletten und bei Bedarf Feldbetten
Verpflegungspakete für mindestens 72 Stunden
Lüftungs- und Filtersysteme, um auch vor Staub, Gas oder Rauch zu schützen
Die Warn-App NINA (Notfall-Informations-und Nachrichten-App) soll künftig über Gefahrenlagen und verfügbare Schutzräume informieren. Die Behörden wollen über GPS und digitale Karten schnelle Hinweise geben, wo sich der nächste offene Schutzraum befindet.
Kosten und Finanzierung
Die Zahlen des BBK-Präsidenten machen deutlich, wie umfangreich das Vorhaben ist:
Mindestens 10 Milliarden Euro werden in den nächsten vier Jahren benötigt, um bestehende Räume herzurichten.
In der laufenden Dekade rechnet das BBK mit einem Bedarf von mindestens 30 Milliarden Euro, wenn neben den 579 bisherigen Schutzräumen auch weitere Tunnel und öffentliche Keller ertüchtigt werden sollen.
Zum Vergleich: Neubaubunker mit hohen Schutzstandards würden den Betrag um ein Vielfaches übersteigen. Durch das Ertüchtigen vorhandener Bauten erhofft man sich eine schnellere und günstigere Lösung.
So sollen Schutzräume funktionieren
Automatisierte Datenbank und App-Suche
Das BBK plant eine zentrale Datenbank, in der alle öffentlichen und privaten Schutzräume elektronisch erfasst sind. Bürgerinnen und Bürger könnten per App (über NINA oder eine andere Katastrophenschutz-App) in Echtzeit sehen:
Standort und Kapazität eines Schutzraums
Zugangsinformationen (Öffnungszeiten, Barrierefreiheit)
Zustand und Ausstattung (etwa vorhandene Betten, Vorräte)
So wird eine automatische Navigationshilfe möglich, die Betroffene zügig zum nächsten freien Platz leitet.
Anwohner schulen und informieren
Gleichzeitig sollen Kommunen:
Risikokarten erstellen, die anzeigen, welche Stadtteile oder Ortschaften besonders gefährdet sind (etwa durch nahegelegene Industrieanlagen oder wichtige Infrastrukturen).
Öffentliche Kampagnen starten, um Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie man den nächsten Schutzraum findet und wie das Verhalten im Ernstfall aussieht (etwa richtiges Verhalten bei Warnsirenen, Ansammlungspunkte, sauberes Verlassen der Zufahrt).
Tag-der-offenen-Tür-Aktionen in sanierten Räumen anbieten, damit sich Anwohner persönlich umsehen und Vertrauen gewinnen können.
Privates Engagement: Bunker im Eigenheim
Während der öffentliche Ausbau in Gang kommt, bauen immer mehr Privatpersonen eigene Schutzbunker:
Beispiel Christian Klaus aus dem Allgäu: Er lässt seinen neuen Keller als Bunker ausführen, mit 45 cm dicken Betonwänden, Filtersystem und Vorratsraum. So kann seine vierköpfige Familie mehrere Monate ausharren, falls eine atomare, biologische, chemische oder konventionelle Bedrohung eintritt.
Bunker-Experte Peter Aurnhammer bestätigt: Seit Beginn des Ukrainekriegs ist die Nachfrage nach privaten Schutzräumen stark gestiegen, viele bieten Platz für mehrere Personen und sind gegen Druckwellen und Gase abgedichtet.
Eigene Bunker sind jedoch teuer: Ein richtig ausgestatteter Familienbunker kostet rasch 100.000 Euro und mehr. Zudem müssen private Modelle regelmäßig gewartet werden – genau wie öffentliche Anlagen, um Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.
Wie Bürger sich zusätzlich schützen können
Selbst wenn der nächste öffentliche Schutzraum in der Nähe ist, empfiehlt es sich, für den Fall einer Verschärfung der Lage eigene kleine Vorräte anzulegen und einen Notfallplan zu erstellen. Wir geben folgende Ratschläge:
Notfallrucksack packen:
Wasser und Lebensmittel (Haltbarkeit mindestens 72 Stunden)
Taschenlampe, Extra-Batterien, Küchenmesser
Ladegeräte für Handy, Powerbank
Kopien wichtiger Dokumente (Ausweis, Versicherungskarte)
Erste-Hilfe-Set und Medikamente für chronisch Kranke
Family-Emergency-Plan:
Einen Treffpunkt vereinbaren, falls Familie auseinandergerissen wird
Kontaktadressen ans Telefonbuch im Handy notieren (auch offline zugänglich)
Nachbarn gegenseitig helfen, damit Ältere und Kranke informiert sind
Eigenen Keller prüfen:
Dichtet Türen und Fenster so ab, dass kein Austritt von Gas oder Staub ins Haus gelangt
Luftfilter mit Aktivkohle besorgen, um im Fall von chemischen Angriffen die Luft zu reinigen
Wasserkanister und Camping-Kocher griffbereit halten
Regelmäßig Warn-Apps installieren und testen:
NINA, KATWARN oder BIWAPP senden amtliche Alarmmeldungen direkt aufs Smartphone.
Probealarme ernst nehmen und Ablauf üben (Treppe hoch- und runterlaufen, Weg zum nächsten Schutzraum).
Diese Vorsorgen können die Überlebenschancen und den Komfort während eines längeren Aufenthalts in einem öffentlichen Schutzraum deutlich verbessern.
Kritik und offene Fragen
Wie schnell klappt die Umsetzung?
Der Zeitplan sieht vor, dass das BBK bis Sommer 2025 ein Konzept vorlegt, doch die Detailplanung der Länder und Kommunen kann Monate dauern.
Bauämter, Denkmalschutz oder Brandschutzvorschriften könnten Umbauten verzögern, etwa wenn ein Parkplatz zu einem Aufenthaltsraum umgebaut wird.
Wer zahlt die Folgekosten?
Die ersten 10 Milliarden Euro sollen im Bundeshaushalt bereitstehen, danach müssen Länder und Kommunen Mitfinanzierungen leisten.
Private Eigentümer können sich Fördermittel für den Umbau von Tiefgaragen oder Kellern sichern, wenn sie diese offiziell als Schutzraum zulassen.
Sind 1 Mio. Plätze genug?
Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner – selbst mit 1 Million Schutzplätzen bleiben viele ungeschützt.
In Ballungsräumen kann der Platzbedarf größer sein, während in dünn besiedelten Regionen möglicherweise zu viele Kapazitäten entstehen.
Diese Fragen zeigt: Ein Schutzraum-Netzwerk muss laufend an reale Bedrohungen angepasst werden, etwa bei neuen Konflikten in Europa oder steigenden Cyberangriffen auf Infrastruktur.
Ausblick: Mehr als Beton und Stahl
Die „rohe“ Zahl von eine Million zusätzlichen Schutzplätzen zeigt, wie ernst die Bundesregierung die Lage einschätzt. Doch es geht nicht nur um Beton und Stahl. Eine gute Infrastruktur allein rettet noch keine Leben, wenn die Menschen nicht wissen, wo sie hinmüssen und wie sie sich vor, während und nach einem Alarm richtig verhalten.
Deshalb sind folgende Punkte entscheidend:
Aufklärung und Schulung: Jeder sollte wissen, wie man eine Warn-App installiert, wo sich der nächste Schutzraum befindet und welche Notfallausrüstung zu Hause bereitsteht.
Kommunale Übungen: In manchen Städten sind schon seit 2024 Notfall-Demos organisiert worden, bei denen Bürger freiwillig Evakuierungen und Aufenthalte in Schutzräumen üben. Das hilft, Hektik im Ernstfall zu vermeiden.
Langfristige Wartung: Ein Bunker, der heute umgebaut wird, muss in regelmäßigen Abständen geprüft werden – etwa Sicherheitsschleusen, Filteranlagen, Generatoren und Vorräte.
Psychosoziale Betreuung: Viele Menschen haben Angst vor Luftangriffen oder chemischen Attacken. Zusätzliche Angebote in der Nachsorge, etwa Krisenhotlines oder Fachärzte für psychische Gesundheit, gehören langfristig zum Zivilschutz dazu.
Nur wenn Beton, Technik und Menschen zusammenarbeiten, kann ein modernes Schutzraum-System funktionieren. Ein Symbol dafür ist die geplante App-Datenbank: Wer am Handy sieht, dass unter der nächsten Tiefgarage ein sicherer Raum ist, bekommt Vertrauen und Orientierung.
Fazit
Deutschland hat die Wartung seiner Schutzräume lange vernachlässigt. Doch mit dem Ziel, eine Million zusätzliche Plätze zu schaffen, zeigt sich das BBK entschieden, wieder einen flächendeckenden Katastrophenschutz aufzubauen.
Die Herausforderung: Technik, Finanzierung, und die menschliche Komponente – also Wissen, Übung und Vertrauen – müssen zusammenpassen. Für Bürgerinnen und Bürger heißt das:
Informieren, welchen öffentlichen Schutzraum Sie in Ihrer Nähe haben.
Aufbau von Vorräten und Notfall-Rucksäcken.
Warn-Apps installieren und testen.
Im Ernstfall ruhig bleiben, Anweisungen folgen und im Schutzraum auf andere achten.
Ob im Keller der eigenen Wohnsiedlung, der nächsten U-Bahn-Station oder im eigens umgebauten Tiefgaragenraum – Schutzplätze entstehen nur, wenn Behörden, Kommunen und Bewohner gemeinsam handeln. Nur so kann Deutschland im Krisenfall Menschenleben schützen und Versorgung zusammenhalten.

